Poetry Slam – das ist performte Lyrik und Kurz-Prosa, die von den Vortragskünsten der Autorin oder des Autors lebt. Nachdem der Deutsch GK sich zunächst mit Texten von Slammern wie Leticia Wahl, Sebastian 23 und Julian Heun beschäftigt und dabei den poetischen Werkzeugkasten gefüllt hatte, war es an der Zeit sich selbst an der Sprachkunst zu versuchen. Das gemeinsame Thema für den Dichterstreit war schnell gefunden, um „Natur und Umwelt“ sollte es gehen.
Hier sind drei der im Unterricht entstandenen Texte.
Donnerwetter
I Die Ruhe vor dem Sturm
Ein sonniger Tag und du gehst spazieren,
die Sonne scheint hell, was könnt schon passieren.
Vögel zwitschern, fliegen wild umher,
ach, solche Tage lieb ich sehr.
Mal Zeit für sich und so viel Ruh,
da verfliegt selbst ein Montag im Nu.
Jetzt noch was zu Essen, das wär‘ was Feines,
ich nehm‘ mir nen Riegel, das ist was Kleines.
Der Ausblick ist schön, man sieht fern und nah,
doch es ist kein Mülleimer da.
Drum werf‘ ich‘s Papier einfach nach hinter mir
und schon kam das Donnerwetter:
84, graues Haar und sehr viel Gemecker.
II Aufbrausen des Sturms
„Junger Mann, so geht das nicht“,
sagt sie nicht leis‘ und ganz erpicht
darauf, mich in Grund und Boden zu reden,
wie bei einem großen Beben,
doch ich bin mir keiner Schuld bewusst,
hab‘ ja nicht viel verschmutzt
und durch dieses Reden wird sich in mir eh nichts ändern,
dacht‘ ich jedenfalls,
doch dieses Gedankenboot ließ sie kentern.
„Stellen Sie sich vor, dass es hier so jeder macht wie Sie.
Dann wäre der Park schnell eine Mülloase,
über die jeder rümpft seine Nase
und auf der Welt gibt’s mehr Parks wie diesen,
die man mit einem Spaziergang kann genießen
und aus bloßer Unachtsamkeit verschmutzen.
Ja, stellen Sie sich vor, dass macht jeder auf der Welt wie Sie.
Nicht nur, dass es eh schon genug Verschmutzung gibt,
die man nicht so leicht wegkriegt.
Sie würden alles Grün zerstören
und dafür braucht man keine blühende Fantasie
oder von Alkohol einen zu viel intus
und auch wenn du denkst, die spinnt bloß,
dann hast du wenigstens für einen Moment nachgedacht
und das wars mir wert.“
III Schäden durch den Sturm
Irgendwie fange ich zu denken an
Und man hört es in mir rattern,
während über mir die Vögel flattern:
Was wäre, wenn das alles nicht wäre
und wo wäre ich dann?
Ein bisschen Müll der Natur geschenkt
sorgt noch nicht für dessen End‘.
Doch tut man ihr mehr Müll schenken
könnt‘s schnell mit dem Ökosystem enden.
Trotz der Übertreibung geb‘ ich der Frau Recht
und frage mich selbst: Wo ist das Problem?
Einfach sein Papier zu nehmen
und in den dafür vorgesehenen Behälter zu schieben,
nur um nicht meinen Komfort zu verlieren?
Ich mein, das Papier ist ja wirklich viel zu schleppen,
vor allem wenn es hochgeht irgendwelche Treppen,
bis ein Mülleimer ist in Sicht.
So wie eben, als ich wurd‘ erwischt,
denn es ist und war kein Mülleimer hier,
sodass sie kam, die Frau mit vier-
undachzig Jahren, grauem Haar
und viel Gemecker,
um mich auf mein egoistisches Verhalten aufmerksam zu machen,
denn nur zusammen kann man es schaffen,
keinen Müll mehr fallen zu lassen,
sonst gibt es nur mich und ich
und ich und mich
und ein Donnerwetter dazu.
Fabian Wachtler
Oben auf dem Hügel
Oben auf dem Hügel
Dort steht ein großer Birnbaum
Es ist ein zauberhafter Garten
Bewohnt von tausend Arten
So mächtig, so prächtig und so rein
Ist der Birnbaum in seinem ganzen Sein
Und selbst wenn das warme Grün seiner Blätter schwindet
So ist die Baumkrone in Dottergelb getaucht
Bis hin zu einem zarten Orange
Das kräftiger ist, als der schönste Sonnenuntergang
Und wenn die Rottöne sich wenden im Winde
Braucht der Baum eine robuste Rinde
Der kunterbunte Blättertanz
Verleiht ihm seinen Glanz
Wenn die bedrohliche Kälte über das Land zieht
Wenn alles von ewigem Weiß bedeckt ist
Dann steht der Birnbaum kahl auf seinem Hügel
Wenn die Strahlen der Sonne das Eis durchbrechen
Dann grünt er von Neuem
Wenn die Natur erwacht
Dann brennt der Birnbaum in einem Feuer der Pracht
Knospen sprießen
Blasse Blüten wachsen
An denen sich die Bienen bedienen
Und wenn die Kinder auf dem Hügel spielen
Auf den die heiße Sommersonne scheint
So spendet er ihnen Schatten
Die Vögel, die einen Ort suchen im Warmen
Lässt er Nester bauen in seinen Armen
Und einen jeden lässt er teilhaben
An der goldgrünen Frucht
Die seine schweren Äste tragen
Und so nimmt er nie ein Ende
Der ewige Kreislauf des Lebens
Oben auf dem Hügel
Dort steht ein großer Birnbaum
Der Leben einhaucht in das Land
Ein Land so schön und weit
Das eines Tages von einem Burschen betreten wird
Auf den Stamm des Baumes legt er seine Hand
Und verliert sich in des Birnbaums Schönheit
Sein Blick führt ihn den Hügel hinab
Auf einen Fluss, der sein Tal formt
Und seinen Weg ins Meer findet
So kommen ihm die Gedanken
Niemand kommt hier lebend heraus
Auch mit mir wird es zuende gehen
Doch werde ich jemals einen Baum pflanzen, auf den ich stolz sein kann?
Tag für Tag bestieg der Bursche den Hügel
Tag für Tag bewunderte er den Birnbaum
Doch er fand keine Antwort
Auf die Frage nach seinem Sinn in der Welt
Tag für Tag wird er unglücklicher
Der Birnbaum freut ihn nicht mehr
So lässt er sein Land hinter sich zurück
Der Fluss wird gerade
Tiefe Stollen hat er gegraben
Die Wälder mit uralten Riesen verschwinden
Doch es reicht ihm nicht
Er baut Fabriken, Flugzeuge, Autos
Abgase verpesten die Luft
Es qualmt, stinkt und raucht
Doch es reicht ihm nicht
Pflanzen verwelkt
Arten ausgestorben
Lebensräume zerstört
Doch es reicht ihm nicht
Der kranke Wald
Der sterbende Himmel
Das Gift der Städte
Doch es reicht ihm nicht
Die Pole geschmolzen
Die Meere ölbedeckt
Tote Tiere vollgefressen mit Plastik
Doch es reicht ihm nicht
Er führt Kriege
Er konsumiert
Er lässt Seinesgleichen verhungern
Doch es reicht ihm nicht
Müllteppiche im Meer
Fettberge am Strand
Die Wärme steigt an
Es reicht ihm nicht
Doch was hat er falsch gemacht?
So macht er kehrt
Zu jenem Hügel
Zu jenem Ort, den er hat geliebt
Oben auf dem Hügel
Dort stand einst ein Birnbaum
Kein Laut, kein Schrei
Dunkle Wolken ziehen am Himmel vorbei
Die Sonne scheint nicht
Der Wind weht nicht
Das Wasser ist jetzt brauner Schlamm
Kein Funke sprüht mehr
Leblos ist das Land
Auf das tote Holz legt er seine Hand
Gedankenlos hat er gehandelt
Dachte er wäre auserkoren
Und könnte die Welt besitzen
Wie ein Parasit, der seinen Wirt benutzt
Hat er die Natur gequält
Hat sein Leben mit Unsinn gewürzt
Und merkt es nur, wenn er selbst betroffen ist
Eines kann er nicht bezwingen:
Die Zeit, die auch für ihn vergeht
Hätte er sich nur eingefügt in diese Welt
So wie der Fluss, der sein Tal formte
Und als Strom den Weg ins Meer fand
Doch hat er sich seine eigene Gruft geschaufelt
Mit seinen unendlichen Wünschen
Auf einem endlichen Planeten
Von dem es keinen zweiten gibt
So denkt er, bis ihm eine Träne kommt
Und ihm schließlich selbst die Luft ausgeht
Alina Fleischer
Frieden der Natur
Ich sehe mich nochmal kurz um,
bevor ich mich dann doch hinsetze,
meine Augen schließe und
es einfach nur genieße.
Der Regen prasselt sanft auf die Blätter
und tropft von da in den Fluss.
Der Fluss fließt, mal leise, mal laut, durch sein Becken,
und ich höre Krokodile planschen und Fische plätschern.
Die vielen Vögel zwitschern, jeder in seiner eigenen Sprache,
fast wie die Menschen, vor sich her, oder miteinander.
Ich höre so viele Geräusche, dass es mir nicht möglich ist,
alle zu trennen und einzeln zu benennen.
Ich höre leises Knacken der Äste oder Schmatzen vom schlammigen Boden.
Ich glaube, das ist ein Tiger oder Jaguar, der sein Revier abläuft und sichert,
fast wie die Menschen es tun.
Ich höre das Kreischen eines Affenkindes, bevor es knackt,
und etwas Schweres dumpf auf dem Boden aufschlägt.
Das Affenkind beginnt zu weinen, bis die Mutter kommt und es beruhigt.
Fast wie bei uns Menschen.
Ich höre das Rascheln der Blätter und der Pflanzen.
Wie sie vom Wind bewegt werden, oder von den vielen verschiedenen Tieren.
Ich spüre, nein, ich kann fast den Wind spüren, die Rinde an meinem Rücken,
die schlammige Erde in meinen Händen.
Das Kitzeln des Grases und der Blätter an meinen Armen
und das kalte Wasser an meinen Beinen und Füßen.
Auf einmal wird der Wind stärker und der Himmel beginnt zu beben.
Es donnert und ein Blitz zuckt auf, den ich sogar durch die geschlossenen Augen sehen kann.
Nein, fast sehen kann.
Ich rieche die kalte, frische, regnerische Luft, die Pflanzen, die Tiere und den Fluss.
Das Holz, die Blätter, die Erde.
Die Freiheit und den Frieden der Natur.
Nein, ich kann es fast riechen.
Trotz des aufziehenden Gewitters bleibe ich sitzen.
Die Blätter des Baums werden mich schützen.
Trocken halten und sichern.
Fast wie ein Haus.
Dennoch höre ich, wie das Zwitschern der Vögel weniger wird,
das Rascheln im Unterholz verschwindet, das Kreischen der Affen leiser wird
und das Stapfen des Tigers verklingt.
Bis nur die Blätter im Wind rascheln, der Himmel bebt,
der Fluss rauscht und der Regen prasselt.
„Nächste Station: Bonner Hauptbahnhof.“
Ich nehme die Kopfhörer ab und stehe auf.
Wohlwissend, dass gleich die Menschenmassen auf mich zu rasen werden,
wie der Regen auf die Blätter.
Aber ich habe keine Wahl.
Ich muss zur Arbeit.
Die Türen öffnen sich und ich quetsche mich durch bis nach draußen.
Ich sehe mich nochmal kurz um und atme die
im Vergleich zum Wald dreckige Luft ein.
Ich drehe mich nochmal kurz um,
bevor ich dann doch los hetze,
meine Welt beobachte und
es einfach nur bedauere.
Yannick Leischner

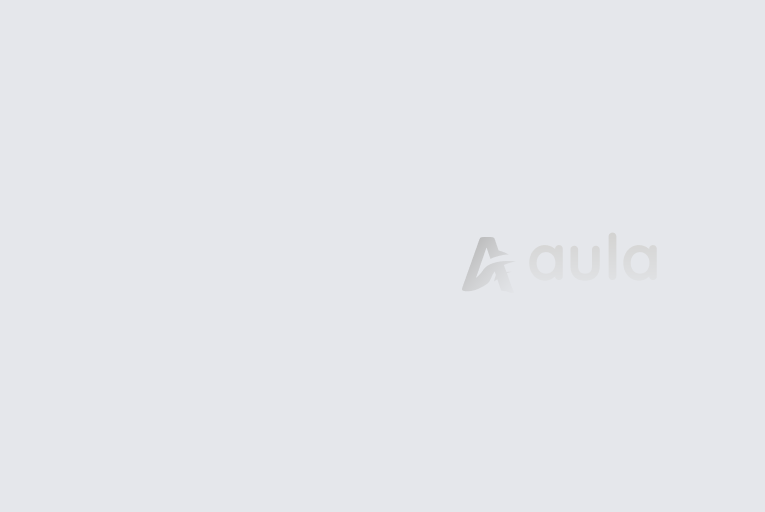

Kommentar schreiben
Kommentare schreiben
Um Kommentare schreiben zu können, musst du angemeldet sein.
Anmelden0 Kommentare